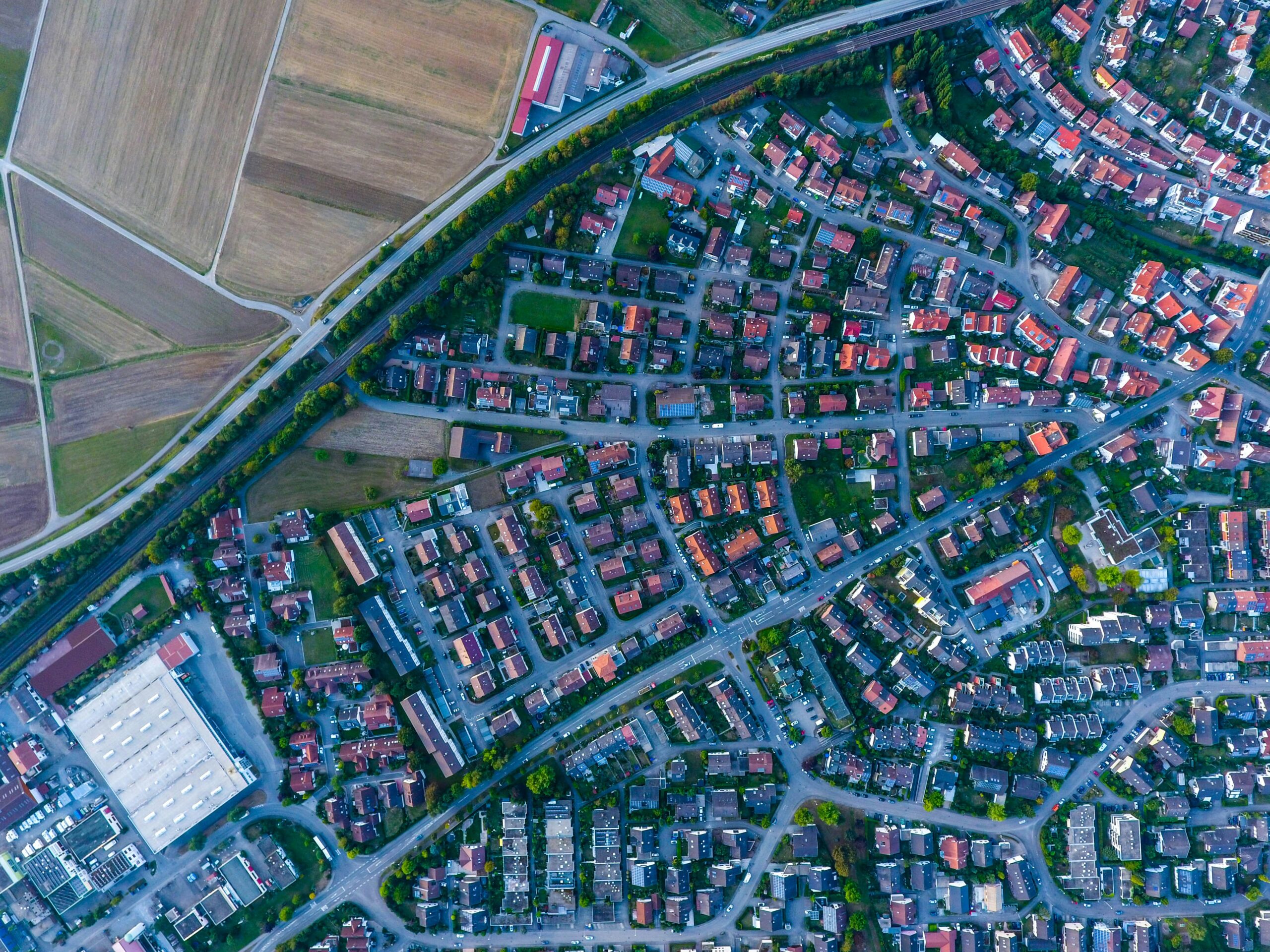Dr. Christina Stresemann ist von Anfang an, seit 2020, Mitherausgeberin der ErbbauZ. Sie war seit 2003 Mitglied und seit 2012 Vorsitzende des auch für das Erbbaurecht zuständigen V. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs. Seit Mai 2022 befindet sie sich im Ruhestand. Dies nehmen wir zum Anlass für einen berufsbezogen-biographischen Rückblick.
Frau. Dr. Stresemann, Sie waren 35 Jahre lang Richterin, zunächst in Berlin, und dann fast zwanzig Jahre am Bundesgerichtshof. Ihr Vater war Dirigent, Ihr Großvater Reichsaußenminister. Hat ein Interesse an Außenpolitik Sie zum Jurastudium gebracht?
Stresemann: Mein Großvater ist in der Tat vor allem als Außenminister von 1923 bis zu seinem frühen Tod im Oktober 1929 bekannt. Er war aber auch Reichskanzler, und gerade hat sich seine Ernennung zum 100 Mal gejährt. Auch wenn er nur 103 Tage in dem Amt blieb, wurden in dieser Zeit die größten Krisen der Weimarer Republik bewältigt: Der drohende Staatsbankrott infolge des passiven Widerstands im besetzten Ruhrgebiet, die gewaltigste Inflation der deutschen Geschichte, Separatistenbewegungen im Rheinland und in Bayern sowie Putschversuche von links und rechts.Obwohl ich nie in die Politik gehen wollte, könnte meine Studienwahl doch durch meinen Großvater beeinflusst worden sein. Mein Vater hat nämlich nicht nur Musik, sondern auf Anraten seines Vaters in erster Linie Jura studiert. Dieser Rat hat womöglich auf mich abgefärbt.
Welche Rolle spielte Gustav Stresemann in der familiären Erinnerung?
Stresemann: Eine große, denn er war durch die Berichte und Erzählungen meines Vaters sehr präsent. Gustav Stresemann hat viel auf die Meinung seines ältesten Sohnes Wolfgang, meines Vaters, gegeben und ihn gelegentlich auch zu politischen Terminen mitgenommen. Mein Vater hat seine Erinnerungen in einem 600 Seiten starken Buch festgehalten. Gustav Stresemanns Ehefrau Käte, in den zwanziger Jahren als junge, elegante Gastgeberin bekannt, habe ich als Großmutter noch erlebt. Sie hatte ihr Leben durch die Emigration in die USA 1937 gerettet, denn den Nationalsozialisten galt die getaufte Protestantin als Jüdin. Auch die beiden Söhne Gustav Stresemanns emigrierten in die USA. Dort traf mein Vater die junge Pianistin Mary Jean Athay, die meine Mutter wurde.
Wenn Sie an Ihre Zeit am Amts- und Landgericht im West-Berlin der achtziger Jahre zurückdenken: ist jungen Juristen von heute diese Zeit überhaupt noch verständlich zu machen oder liegt sie uns eigentlich nah – ich denke an die Weltuntergangsstimmung, die Aggressivität der politischen Auseinandersetzung?
Stresemann: Auch in den achtziger Jahren gab es Gründe, wenig hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen: Konfrontationen zwischen den USA und der Sowjetunion und das Wettrüsten im Kalten Krieg, Hungersnöte in Afrika, Waldsterben, hohe Arbeitslosigkeit, Aids und die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Verrohung und Aggressivität in Internet und den Sozialen Medien sind zwar neu für die Bundesrepublik, aber die öffentlichen Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik waren sehr viel gewalttätiger als heute. Hunderte politische Morde zeugen davon; die Politiker Matthias Erzberger, Karl Gareis, Hugo Haase und Walther Rathenau waren deren prominenteste Opfer. Die Entwicklung in der Weimarer Republik zeigt, wie wichtig es ist, dass die Mitte der Gesellschaft sich radikalen Tendenzen entschlossen entgegenstellt.
Was unterscheidet, wenn Sie einen Blick auf Ihre früheren und heutigen, jetzt ehemaligen Kollegen werden, die Lage eines Zivilrichters im alten West- Berlin von der heute?
Nicht viel, von ein paar technischen Neuerungen und Gesetzesreformen abgesehen. Bürgerliches Gesetzbuch und Zivilprozessordnung galten auch in West-Berlin, ebenso die Grundrechte des Grundgesetzes. Allerdings konnte das Bundesverfassungsgericht wegen der alliierten Vorbehalte keine Berliner Entscheidungen überprüfen, und bis 1992 hatte Berlin auch kein Landesverfassungsgericht.
Sie wurden Mitte 1989 persönliche Referentin der damaligen (West)Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Tätigkeit in den Monaten vor dem Mauerfall?
Stresemann: Ich kannte Frau Limbach von der Freien Universität und habe ihren Wechsel von der Professorin zur Politikerin mit großem Interesse verfolgt. Sie musste sich zunächst Respekt verschaffen gegenüber den Beamten der Justizverwaltung, die dem ersten rot-grünen Senat in Berlin, der zudem mehrheitlich mit Frauen besetzt war, äußerst skeptisch gegenüberstanden. Inhaltliche Schwerpunkte waren damals Reformen im Strafvollzug und die Auflösung der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft, die in dem Ruf stand, besonders rigoros gegen die politische Linke vorzugehen.
Worin lagen die größten Herausforderungen der Berliner Justizsenatorin nach dem 9. November 1989?
Stresemann: Vor allem in der Neuorganisation der Berliner Justiz. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde Berlin ein einheitliches Bundesland. Damit mussten die Ost- und die Westberliner Justiz zusammengeführt werden, und das erforderte Modifikationen der geplanten Übergangsregelungen für Richter und Staatsanwälte im Einigungsvertrag. Frau Limbach hat sich mit Nachdruck für eine Auflösung der Ostberliner Gerichte und einer Erstreckung der Westberliner Justizstruktur auf die gesamte Stadt eingesetzt. Sie hatte klare Ziele vor Augen und keine Furcht, sich unbeliebt zu machen. Anders als in den anderen neuen Ländern wurden die Richterinnen und Richter Ost-Berlins nicht in den Justizdienst übernommen; sie waren praktisch entlassen und mussten sich einem aufwendigen Neueinstellungs- und Überprüfungsverfahren stellen. Nur wenige gelangten nach dem 3. Oktober 1990 wieder in den Justizdienst.
Die zweite große Herausforderung war die Aufarbeitung der DDR-Regierungskriminalität. Da diese von der Hauptstadt der DDR ausgegangen war, lag die Zuständigkeit bei der Berliner, d. h. der West-Berliner Staatsanwaltschaft, die zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben auch schon die allgemeine Strafverfolgung im Ostteil der Stadt zu bewältigen hatte. Die bei der Staatsanwaltschaft Berlin gebildete Arbeitsgruppe Regierungskriminalität wurde durch abgeordnete Staatsanwälte aus anderen Bundesländern verstärkt, wenn auch nicht in dem erforderlichen und von Frau Limbach gewünschten Umfang.
Meinen Sie aus heutiger Sicht, man hätte damals verschiedene Dinge – zB Stichwort Mauerschützenprozesse – vielleicht anders angehen müssen?
Stresemann: Das meine ich nicht. Der Justiz ist oft vorgeworfen worden, sie habe mit zweierlei Maß gemessen. Natürlich ist man an das DDR-Unrecht ganz anders herangegangen als an das nationalsozialistische Unrecht. Falsch war aber nicht das Vorgehen gegen das DDR-Unrecht, sondern, wie auch der Bundesgerichtshof 1995 deutlich gemacht hat, das Unrecht der Nachkriegsjahrzehnte, in denen die NS-Verbrechen weitgehend ungesühnt blieben. Nach den Mauerschützenprozessen hatte es zunächst so ausgesehen, als wolle man wieder die Kleinen hängen und die Großen laufen lassen. Aber nachdem die Mauerschützen wegen der Schüsse an der Mauer als Täter verurteilt worden waren, hat man die Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats ebenfalls als Täter verurteilt. Die neuartige Konstruktion des „Täters hinter dem Täter“, die dafür entwickelt wurde, halte ich für sehr sinnvoll. Nur hätte sie die Justiz 50 Jahre früher anwenden müssen.
Wenn Sie Ihre später in Karlsruhe fortgesetzte langjährige Zusammenarbeit mit Frau Limbach insgesamt in den Blick nehmen: was sollte von Frau Limbach in Erinnerung bleiben?
Stresemann: Ihre Gradlinigkeit, Unabhängigkeit, Nachdenklichkeit und Zielstrebigkeit gepaart mit Geist, Witz und großer Liebenswürdigkeit sind in dieser Kombination unerreicht. Sie hat über Parteigrenzen hinweg gedacht und agiert und nie die Bodenhaftung verloren. Und sie wusste, wie wichtig es ist, der Öffentlichkeit die Arbeit der Institutionen nahezubringen. Es ist kein Zufall, dass die Pressestelle im Bundesverfassungsgericht, übrigens gegen erhebliche Widerstände aus der Richterschaft, von ihr geschaffen wurde.
Seit 2003 waren Sie beim V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs tätig. Können Sie zunächst etwas zur Gliederung des BGH in Senate sagen – ändert sich beispielsweise die thematische Zuordnung alle paar Jahre?
Stresemann: Der Bundesgerichtshof besteht mittlerweile aus 13 Zivil- und sechs Strafsenaten. Die Zivilsenate sind für bestimmte Rechtsgebiete zuständig, beispielsweise der II. Zivilsenat für das Gesellschaftsrecht, der IV. Zivilsenat für das Versicherungs- und Erbrecht, der VIII. Zivilsenat für Kaufrecht und Wohnraummietrecht. Die Zuständigkeit der Strafsenate bestimmt sich grundsätzlich danach, aus welchem Gerichtsbezirk das angefochtene Urteil stammt; daneben gibt es sachgebietsbezogene Zuständigkeiten zB für das Steuerstrafrecht (1. Strafsenat), Verkehrsrecht (4. Strafsenat) oder Staatsschutzdelikte (3. Strafsenat). Einen turnusmäßigen Wechsel der Zuständigkeiten gibt es nicht. Veränderungen werden vom Präsidium nur vorgenommen, um „Unwuchten“ in der Belastung auszugleichen. Bei den Zivilsenaten war dies zuletzt aufgrund der „Dieselverfahren“ notwendig; schließlich musste sogar ein Hilfssenat eingesetzt werden.
Gibt es Unterschiede im Prestige zwischen den Senaten? Und streben Bundesrichter in der Regel danach, in ihrer Berufslaufbahn immer in demselben Senat zu bleiben?
Stresemann: Welches „Prestige“ ein Senat hat, liegt im Auge des Betrachters. Ist das Wettbewerbsrecht wichtiger als das Konkursrecht? Verdient das Presserecht größere Aufmerksamkeit als das Mietrecht? Ich kann da keine Hierarchie erkennen. Der V. Zivilsenat ist jedenfalls für alles Bodenständige zuständig: Grundstücksrecht einschließlich des Erbbaurechts, Nachbarrecht, Wohnungseigentum, Zwangsversteigerung, Grundbuchrecht, auch das Recht der beweglichen Sachen fällt in seine Zuständigkeit. Vor allem die Nachbarschaftsstreitigkeiten stoßen regelmäßig auf großes Interesse. Ob ein Baum gefällt werden muss, weil er zu nah an der Grenze steht, den Garten des Nachbarn verschattet, seine Wurzeln eine Zufahrt anheben oder weil er zu viel Laub abwirft – alles Probleme, die jedermann bekannt sind und zu denen jeder eine Meinung hat. Bundesrichter wechseln nur selten in einen anderen Senat. Das kommt vor allem vor, wenn jemand anfangs nicht in dem Sachgebiet eingesetzt wurde, in dem er oder sie bevorzugt arbeitet. Wer in „seinem“ Senat zufrieden ist, bleibt dort in aller Regel. Denn die Einarbeitungszeit ist beträchtlich. Mir wurde anfangs gesagt, es bräuchte zwei Jahre, bis man ein vollwertiges Senatsmitglied sei. Ich hielt das damals für übertrieben, das ist es aber nicht. Es dauert lange, bis man die Rechtsprechung des eigenen Senats in seiner ganzen Bandbreite kennt und verinnerlicht hat. Und deshalb ist die Neigung gering, in einen anderen Senat zu wechseln und dort wieder von vorn zu beginnen.
Wie sieht denn der typische Arbeitstag einer Bundesrichterin aus?
Stresemann: Man muss gerne am Schreibtisch sitzen, denn dort verbringt man viel Zeit. Ein Bundesrichter hat in erster Linie sog. Voten zu erstellen, das sind ausgearbeitete Entscheidungsvorschläge für die Verfahren, die einem zugeteilt sind. Da gilt es, den Fall zu analysieren, eine Lösung auf der Grundlage und gegebenenfalls unter Weiterentwicklung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch unter Berücksichtigung der vielfältigen Auffassungen in der Rechtsliteratur zu finden und eine Entscheidung auszuformulieren. Die anderen vier zur zuständigen „Spruchgruppe“ gehörenden Senatsmitglieder erhalten diese Ausarbeitung zusammen mit dem angefochtenen Urteil eine Woche vor der Beratung, um zu prüfen: Stimmt man dem Ergebnis zu? Und auch der Begründung? Sollten womöglich weitere Aspekte herausgestellt oder Parallelen zu anderen Entscheidungen herausgearbeitet werden? Die kritische Durchsicht der Voten der anderen Senatsmitglieder, also die Vorbereitung auf die gemeinsame Beratung, ist enorm wichtig, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Unvorbereitet kann man kaum etwas zur Beratung beitragen. Die Beratungen waren für mich ein „Highlight“ der Senatsarbeit. Die Diskussion zu fünft bringt neue Aspekte hervor; selten bleibt das Votum des Berichterstatters unverändert. Hinzu tritt die mündliche Verhandlung, in der die hochqualifizierten und mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestens vertrauten Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen am Bundesgerichtshof oft weitere Gesichtspunkte beisteuern. Am meisten Zeit verbringen Richter und Richterinnen aber, wie gesagt, aber mit der Erstellung der eigenen Voten. Je nach Komplexität des Falls kann ausnahmsweise ein Nachmittag ausreichen, meist sind es aber mehrere Tage oder auch Wochen. Liegt bereits die Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters vor (sog. Vorvotum), ist dies in der Regel eine große Arbeitserleichterung.
Bringen wissenschaftliche Mitarbeiter tatsächlich eine substantielle Arbeitsentlastung? Man muss doch die einzelnen Fälle ohnehin alle selbst beherrschen?
Stresemann: Natürlich muss der zuständige Berichterstatter den Fall selber durchdenken. Die Vorarbeit des wissenschaftlichen Mitarbeiters erleichtert das aber. Es gibt bisweilen Vorvoten, die so gut sind, dass sie dem Senat praktisch ohne Änderungen vorgelegt werden können. Die drei wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einem Senat zugewiesen sind, können aber nur einen kleinen Teil der Verfahren bearbeiten. Meist werden sie für besonders komplexe Fälle eingesetzt und entlasten die Berichterstatter schon durch die Aufarbeitung des Tatsachenstoffs sowie durch Sammlung der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur zu kniffeligen Rechtsfragen.
Welches Urteil ist Ihnen besonders in Erinnerung?
Stresemann: Das ist ein Urteil nicht aus dem Grundstücksrecht, sondern dem Recht der beweglichen Sachen, nämlich zur Plakatsammlung Sachs. Es ging um eine Kunstsammlung, die dem Berliner Zahnarzt Hans Sachs gehörte und ihm im Auftrag des Berliner NSDAP-Gauleiters Josef Goebbels vor seiner Emigration in die USA abgepresst worden war. Nach der Wiedervereinigung verlangte Sachs‘ Sohn die Plakate vom Deutschen Historischen Museum heraus. Der V. Zivilsenat hat der Klage – übrigens entgegen dem Votum der sog. Limbach-Kommission – stattgegeben. Möglich wurde dies durch das „Washingtoner Abkommen“, welches es der öffentlichen Hand verwehrt, die Einrede der Verjährung zu erheben. Es erfüllt mich mit Genugtuung, dass das Recht, wenn auch sehr spät, einen Akt nationalsozialistischer Willkür aus der Welt geschaffen hat.
Und welche Rolle spielt das Erbbaurecht in der Arbeit des Bundesgerichtshofs? Gilt es als exotische Nische?
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Erbbaurecht im Mittelpunkt steht, gibt es nur sehr wenige. In der Statistik werden sie nicht gesondert erfasst. In den letzten Jahren gab es wohl die eine oder andere erfolglose Nichtzulassungsbeschwerde, aber leider keine Sachentscheidung aus diesem Rechtsgebiet. Dabei liegt das Erbbaurecht dem V. Zivilsenat am Herzen. Seine Bedeutung unterstreicht eine Regelung im senatsinternen Geschäftsverteilungsplan des Senats. Es gehört neben dem Wohnungseigentumsrecht und dem Immissionsschutzrecht zu den Rechtsgebieten, bei denen ein bestimmtes Senatsmitglied stets an der Entscheidungsfindung zu beteiligen ist. Damit wird sichergestellt, dass neben der Vorsitzenden ein weiteres Senatsmitglied den Überblick über die Rechtsprechung zum Erbbaurecht behält. Die Berichterstattung kann aber bei jedem liegen; gerade weil neue Kolleginnen und Kollegen zuvor meist wenig Berührung mit dem Erbbaurecht hatten, ist es wichtig, dass sie sich mit eigenen Voten in die Materie einarbeiten.
Wie oft hatten Sie in Ihrer Tätigkeit mit erbbaurechtlichen Fragen zu tun, und was waren das für Fälle?
Stresemann: Es mögen etwa 20 Fälle gewesen sei, die spezifisch erbbaurechtliche Fragen aufwarfen. Für besonders bedeutsam halte ich ein Urteil aus dem Jahr 2015, mit dem entschieden wurde, dass (auch) eine öffentliche Körperschaft in einem Erbbaurechtsvertrag Verwendungsbeschränkungen und Heimfallrechte für die gesamte Dauer des Erbbaurechts vereinbaren darf (V ZR 144/14). Eine Gemeinde kann auf diese Weise beispielsweise erreichen, dass Wohngebäude nur durch Einheimische genutzt werden. Voraussetzung ist aber, dass die Gemeinde das dazugehörige Grundstück nicht verkauft, sondern mit einem Erbbaurecht belastet. Auf die Vorteile, die die Ausgabe von Erbbaurechten für die öffentliche Hand bietet, weist der V. Zivilsenat immer wieder hin (siehe zB V ZR 176/17 Rn. 21 u. V ZR 306/16 Rn. 28). Juristisch interessant ist ferner die Schnittstelle von Erbbaurecht und Zwangsversteigerung, etwa die Frage, ob ein Grundstückseigentümer seine Zustimmung zur Zuschlagser- teilung verweigern oder einen Heimfallanspruch geltend machen kann, wenn der Ersteher sich weigert, in den schuldrechtlichen Erbbaurechtsvertrag einzutreten (V ZB 186/15 u. V ZR 165/14). Andere wichtige Entscheidungen betrafen den Erbbauzins, beispielsweise die Auslegung von Anpassungsklauseln (V ZR 225/15 u. V ZR 110/09) oder die Frage, ob der Zins wegen der Schließung eines nahegelegenen bekannten Kaufhauses oder des Wegfalls der Anschlussförderung im öffentlichen Wohnungsbau verringert werden kann (V ZR 42/15 u. V ZR 6/13) oder auch, ob er bei einer infolge veränderter Bauleitplanung stärkeren baulichen Nutzbarkeit des Grundstücks erhöht werden darf (V ZR 208/12).
Sie waren zwischen 2009 und 2022 Beauftragte des Bundesgerichtshofs für Auslandskontakte. Was hat denn ausländische Richterkollegen am Bundesgerichtshof vor allem interessiert?
Stresemann: Von großem Interesse war immer wieder, wie es gelingt, die Verfahren, die den Bundesgerichtshof erreichen, so zu begrenzen, dass sie innerhalb angemessener Zeit erledigt werden können. Die Obersten Gerichtshöfe vieler Länder sind überlastet und suchen nach Wegen, den Zugang zur Revisionsinstanz zu beschränken. Beim Bundesgerichtshof wird dies in Zivilverfahren durch die Notwendigkeit der Revisionszulassung, einer 20.000 Euro übersteigende Beschwer für eine Nichtzulassungsbeschwerde und, was vielfach übersehen wird, durch die Rechtsanwaltschaft am Bundesgerichtshof bewirkt. Deren Mitglieder können es sich leisten, Parteien von der Einlegung aussichtsloser Rechtsmittel abzuraten und tun dies auch. Gleichzeitig arbeiten sie die Verfahren – auch solche mit kleinem Streitwert – hervorragend auf und entlasten durch ihre strukturierten und auf das Wesentliche beschränkten Schriftsätze die Richterinnen und Richter.
Seit Jahrzehnten wird die Einflussnahme der Parteien auf die Zusammensetzung von Obergerichten kritisiert. Die Süddeutsche Zeitung etwa schrieb am 11. März 2019 zur Wahl der Richter am BGH: „Union und Sozialdemokraten können die Stellen weitgehend unter sich aufteilen. Fähige Juristen, die keiner Partei nahestehen, werden bei der Wahl oft nicht berücksichtigt.“ Aber hat die parteipolitische Einflussnahme nicht ihre Vorteile?
Stresemann: Es hat legitimatorischen Wert, dass die Bundesrichter von einem Richterwahlausschuss gewählt werden, dem die 16 Justizminister der Länder, 16 Mitglieder des Bundestags und der Bundesjustizminister angehören. Letzterer hat zwar kein Stimmrecht, er muss der Wahl aber zustimmen. Damit ist parteipolitischer Einfluss nicht auszuschließen. Es ist aber keineswegs so, dass nur gewählt wird, wer einer Partei angehört oder nahesteht. Richtig ist allerdings, dass ein Bewerber keine Chancen hat, wenn sich niemand aus dem Richterwahlausschuss für seine Wahl einsetzt. Fähige Richter und Richterinnen werden aber häufig durch den Justizminister oder die Justizministerin ihres Heimatlandes gefördert, und zwar unabhängig von einer Parteizugehörigkeit. Bisweilen kann auch der Bundesgerichtshof Signale senden, wenn ein aus seiner Sicht besonders geeigneter Kandidat zur Wahl steht. Über seinen Präsidialrat nimmt er ohnehin zu der Qualifikation der Bewerber und Bewerberinnen ausführlich Stellung.
Wenn Sie beauftragt wäre, die Richterwahl zum BGH gesetzlich neu zu regeln: Was würden Sie tun?
Stresemann: Ich würde zwar an der Wahl durch den Bundesrichterwahlausschuss festhalten, sie aber von einer Zwei-Drittel-Mehrheit abhängig machen. Derzeit genügt die einfache Mehrheit, was zu der beklagten Dominanz von CDU und SPD bei der Stellenbesetzung führt. Ist eine breitere Mehrheit erforderlich, müssten die anderen Parteien in die von der Süddeutschen Zeitung beschriebene Vorabstimmung einbezogen werden.
Eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat sich bei der Wahl der Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts bewährt. Sie erfordert einen breiten Konsens der Wahlberechtigten und verhindert, dass eine Partei „Hardliner“ durchsetzt. In der Folge sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts häufig von einer konstruktiven Zusammenarbeit der Richterinnen und Richter getragen und stoßen wohl auch deshalb meist auf große Akzeptanz in der Bevölkerung. Sehr viel anders sieht es am amerikanischen Supreme Court aus. Ein US-Präsident, dessen Partei die Mehrheit im Senat hat, kann mit der Besetzung von Richterstellen die Rechtsprechung des Gerichts auf Jahre hin prägen. Ich wäre sehr dafür, das derzeitige Zustimmungsquorum für die Wahl von Bundesverfassungsrichtern im Grund- gesetz zu verankern. Derzeit ist es nur in einem einfachen Gesetz enthalten und könnte dereinst von einer Mehrheit im Bundestag geändert werden, die größeren Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts nehmen will.
Vor einigen Jahren wurde über Ihre erfolgreiche Klage gegen einen AfD-nahen Verein, der eine „Gustav-Stresemann-Stiftung“ gründen wollte, überregional berichtet. Können Sie diesen Konflikt im Umriss darstellen?
Stresemann: Die AfD plante damals die Gründung einer parteinahen Stiftung und war auf der Suche nach einem Namen für sie. Ein Teil der Partei favorisierte den Namen „Gustav Strese- mann“ und wollte zu diesem Zweck einen offenbar vorsorglich gegründeten Verein aus Jena nutzen, der sich „Gustav- Stresemann-Stiftung“ nannte. Mein Bruder und ich waren entsetzt, denn die auf Ausgleich, Verständigung und ein geeintes Europa gerichtete Politik unseres Großvaters hat nicht nur keine Verbindung mit den Zielen und dem Auftreten der AfD, sie steht sogar in krassem Gegensatz dazu. Schnell wurde klar, dass ein Rechtsstreit unumgänglich sein würde, und wir haben gestützt auf unser Namensrecht und auf das „postmortale Persönlichkeitsrecht“ unseres Großvaters von dem genannten Verein verlangt, sich nicht länger Gustav-Stresemann-Stiftung zu nennen. Das Landgericht Berlin hat der Klage auf der Grundlage des Namensrechts wegen drohender „Namensverwirrung“ stattgegeben. Denn in Öffentlichkeit hätte der Eindruck entstehen können, mein Bruder und ich seien mit der Namensverwendung einverstanden und sympathisierten mit der AfD. Andere parteinahe Stiftungen, wie zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung, haben die Nachfahren selbstverständlich gefragt, ob sie den Namen des berühmten Vorfahren nutzen dürfen. Das Urteil des Landgerichts ist rechtskräftig geworden, und ich bin immer wieder erleichtert, dass die AfD ihre Stiftung nicht nach meinem Großvater nennen darf.
Wie würden Sie denn, und damit schließt sich der Kreis, das politische Anliegen Ihres Großvaters zusammenfassend kennzeichnen?
Stresemann: Er wollte Deutschland durch eine Politik der Verständigung und des Interessenausgleichs in Europa zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückführen. Seine Politik war eine der Mitte, unter ihm regierte zum ersten Mal in der Weimarer Republik eine wirklich Große Koalition aus SPD, Zentrum, linksliberaler Deutscher Demokratischer Partei und seiner Partei, der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei. Heute entspräche das einer Koalition zwischen SPD, CDU und FDP. Außenpolitisch erreichte er mit den Verträgen von Locarno die Aussöhnung mit Frankreich; hierfür erhielten er und sein französischer Amtskollege Aristide Briand 1926 den Friedensnobelpreis. Ein Erfolg seiner Politik war auch die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund; der Verlierer des Ersten Weltkriegs wurde keine zehn Jahre nach seiner Niederlage wieder in die Staatengemeinschaft aufgenommen. Leider war das Erreichte nicht von Dauer. Schon 1933 erklärte die Hitler-Regierung den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund und begann sechs Jahre später sogar einen Weltkrieg. Nimmt man freilich größerer Zeiträume in den Blick, erkennt man die dauerhaft große Leistung von Briand und Stresemann in der von de Gaulle und Adenauer besiegelten europäischen Nachkriegsordnung. Nach der endgültigen Aussöhnung mit Frankreich, der Gründung der Europäischen Union und der Wiedervereinigung Deutschlands ist das erreicht, wovon mein Großvater träumte.Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Dr. Stresemann!
Erschienen in: ErbbauZ 2023/4